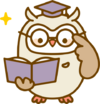Vorlage:KinderEule: Unterschied zwischen den Versionen
Zur Navigation springen
Zur Suche springen
(Der Seiteninhalt wurde durch einen anderen Text ersetzt: „==<div style="border:1px solid #808080; margin:5px 3px 0px 3px; padding:0 5px 2px 5px; background:#EEEEEE">Seite für Kinder in einf…“) Markierung: Ersetzt |
|||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
Die gelb hinterlegten Quellen sind fiktive, also nachgestellte Quellen. | Die gelb hinterlegten Quellen sind fiktive, also nachgestellte Quellen. | ||
Bei den weiß hinterlegten Quellen handelt es sich um historische, also echte Quellen. | Bei den weiß hinterlegten Quellen handelt es sich um historische, also echte Quellen. | ||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||
| − | |||